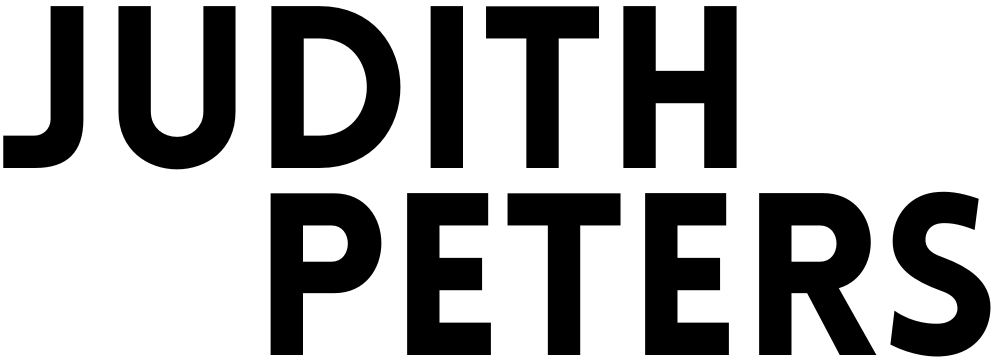Die garantiert beste Kreativitätsübung der Welt: MACHEN! Und was uns vom Machen zurückhält.

Wochenlang schiebe ich einen Blogbeitrag vor mir her, der so anfängt:
Wahrscheinlich stehen jeden Tag Millionen Menschen in den Museen dieser Welt vor einem Kunstwerk und denken sich: Das kann ich auch. Was ist denn daran besonders? Ist ja nur ein bisschen Herumgespritze, dann noch ein paar Pinselstriche und fertig. Wenn ich Zeit hätte, ja dann könnte ich das auch.
Meine These ist: Der einzige Unterschied zwischen einem Künstler und einem Normalo ist weder Talent, Ausbildung noch Geld, sondern: Machen. Der Künstler…
So. Weiter kam ich nicht. Vor zwei Wochen waren wir spontan im Urlaub, wir sind nach Budapest gefahren. Dort haben wir Lászlós besten Freund besucht, Horváth Daniel (Fun Fact: in Ungarn schreibt man zuerst den Nachnamen, dann den Vornamen. Die Leute stellen sich dort auch so vor). Er arbeitet im Bankensektor. Sein größtes Hobby: Malen. Und als er mir erzählt hat, wie er zum Malen kam, hatte ich ein matrix’eskes Déjà vu:
Er erzählte mir, wie er in einem Museum ein Gemälde gesehen und sich gedacht hat: „Das kann ich auch“. Vom Museum ist er direkt in einen Laden für Künstlerbedarf gegangen und hat sich Leinwände, Farbe und Pinsel gekauft. Und dann hat er losgelegt. Einfach so. Verrückt, oder?
Nein, eigentlich gar nicht verrückt. Das Verrückte ist, dass viele Menschen diesen Gedanken haben („das kann ich auch“), dann aber keinen Stift oder Pinsel in die Hand nehmen. Warum eigentlich nicht? Ich habe da so meine Vermutung…
Die größten Gegner des Machens:
Anfangen und Machen sind untrennbar mit Kreativität verbunden. Es gibt gute Techniken bzw. Übungen, wie man ins Machen kommen kann. Mehr dazu bald. Man muss halt mal anfangen mit dem Anfangen ;-) Übrigens: Vor Kurzem hat Dániel sein erstes Gemälde in die USA verkauft. Ganz ohne Kunstausbildung oder eigene Webseite. Verrückt, oder?